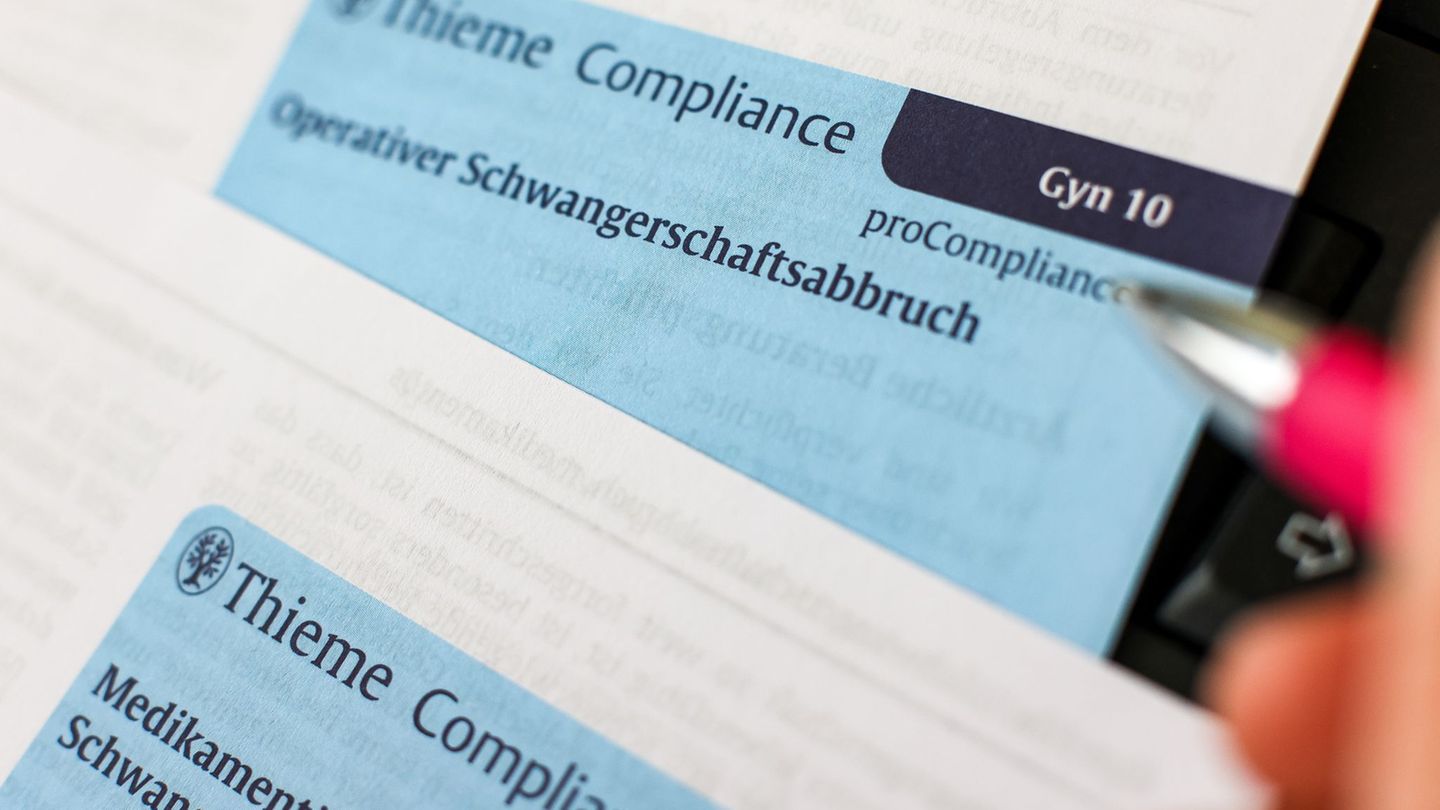Bekommt Berlin wie von CDU und SPD angekündigt ein Vergesellschaftungsrahmengesetz? Noch ist das Gutachten dazu nicht einmal in Auftrag gegeben.
Die schwarz-rote Regierungskoalition kommt beim Vergesellschaftungsrahmengesetz kaum voran. Das zeigt die Antwort der Finanzverwaltung auf eine schriftliche Anfrage der Grünen-Abgeordneten Katrin Schmidberger. Das lang angekündigte Rechtsgutachten dazu ist bisher nicht vergeben worden. Das soll nun „Ende April/Anfang Mai“ passieren. Der Ausschreibungstext befinde sich noch in der Abstimmung, so die Finanzverwaltung.
Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hatte im September angekündigt, das juristische Gutachten werde „in nächster Zeit“ in Auftrag gegeben. Genaue Kosten zu nennen, sei nicht möglich, erklärte seine Verwaltung. Der Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses habe aber einer Vergütung in Höhe von bis zu 100.000 Euro zugestimmt.
Gesetzentwurf soll noch vor der nächsten Wahl kommen
Ein Entwurf für ein Vergesellschaftungsrahmengesetz soll dann „im letzten Jahr der laufenden Legislaturperiode“ vorliegen – die nächste Abgeordnetenhauswahl ist im Herbst 2026.
Das Gesetz soll den Rahmen setzen für mögliche staatliche Eingriffe im Bereich der Daseinsvorsorge. Dazu gehören neben Wohnen auch Bereiche wie Energie, Wasser und Gesundheitsversorgung.
Mit dem Gutachten soll unter anderem geklärt werden, wie eine Regelung möglich ist, die auch einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten würde.
CDU und SPD haben das Gesetz vor zwei Jahren verabredet
CDU und SPD hatten das Vergesellschaftungsrahmengesetz 2023 im Koalitionsvertrag verabredet. Das Vorhaben ist eine Konsequenz aus dem erfolgreichen Volksentscheid für die Enteignung großer Wohnungskonzerne 2021.
Dabei hatten gut 59 Prozent der Wählerinnen und Wähler – mehr als eine Million Menschen – für die Enteignung und Entschädigung von Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen in Berlin gestimmt.
Sie hoffen, dass auf diese Weise der unablässige Anstieg der Mieten in der Stadt gestoppt werden kann. Der Abstimmung lag allerdings kein Gesetzentwurf zugrunde, weshalb die Politik nicht verpflichtet war, das Votum umzusetzen.
Unter anderem die Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“, die den Volksentscheid angestoßen hatte, hat dem Senat immer wieder vorgeworfen, das Abstimmungsergebnis zu ignorieren.